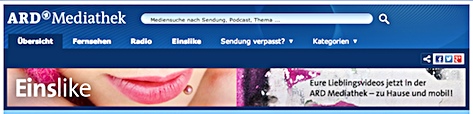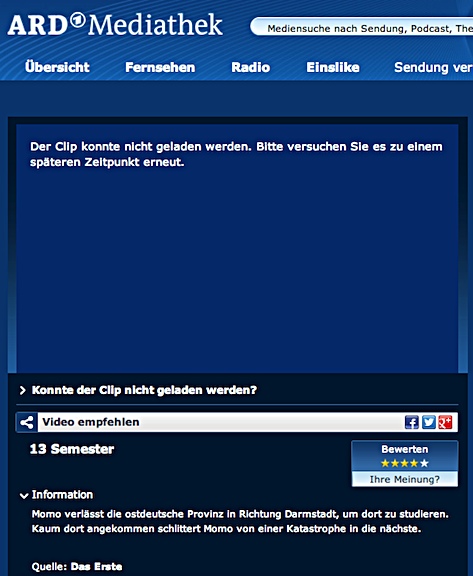Das Bundeskriminalamt führt zahlreiche Dateien mit Personen- und Sachdaten, die in der INPOL-Datensammlung zusammengefasst sind. Hierzu gehören Verbunddateien (werden von Landeskriminalämtern gespeist) und Zentraldateien (BKA speichert selbst), die von allen Polizeibehörden in Deutschland eingesehen werden können. Hinzu kommen die Amtsdateien, wo das BKA Informationen verarbeitet die andere Stellen zunächst nicht erhalten
Das Bundeskriminalamt führt zahlreiche Dateien mit Personen- und Sachdaten, die in der INPOL-Datensammlung zusammengefasst sind. Hierzu gehören Verbunddateien (werden von Landeskriminalämtern gespeist) und Zentraldateien (BKA speichert selbst), die von allen Polizeibehörden in Deutschland eingesehen werden können. Hinzu kommen die Amtsdateien, wo das BKA Informationen verarbeitet die andere Stellen zunächst nicht erhalten einsehen können.
Als zentrale Kontaktstelle für die internationale Zusammenarbeit tauscht das BKA seine Erkenntnisse auch mit Behörden anderer Länder. Daten werden per “Data Loader” zur EU-Polizeiagentur EUROPOL gepusht oder in das inzwischen aufgerüstete Schengener Informationssystem (SIS II) eingebunden.
Mittlerweile verlagert sich die Nutzung polizeilicher Datenbanken immer mehr ins Vorfeld. Das bedeutet, dass nicht mehr nur rechtskräftig verurteilte Personen gespeichert werden. Eine einfache polizeiliche Maßnahme genügt, um aktenkundig zu werden. Hierzu gehört etwa eine Personenkontrolle oder ein Platzverweis am Rande einer Demonstration.
Seit einigen Jahren führt das BKA die Zentraldatei “Politisch motivierte Kriminalität – links” (“PMK-links-Z”) zu linken, politischen AktivistInnen. Auch Datensätze aus der inzwischen aufgelösten Datei “International agierende gewaltbereite Störer” (IgaSt) werden nun in der “PMK-links-Z” geführt. Durch ihre elektronische, grafische Auswertung will das BKA Strukturen ausforschen. Zu ihrer Errichtungsanordnung heißt es seitens des Bundesinnenministeriums:
Sie ermöglicht vor allem das Erkennen von relevanten Personen, Personengruppierungen, Institutionen, Objekten und Sachen sowie das Erkennen von Verflechtungen bzw. Zusammenhängen zwischen Personen, Personengruppierungen, Institutionen, Objekten und Sachen.
In der “PMK-links-Z” werden aber auch “Sonstige Personen”, also Kontakt- und Begleitpersonen geführt. Es ist beispielsweise vorgekommen, dass eine bereits gespeicherte Person bei der Ausreise zu einer internationalen Demonstration an der Grenze kontrolliert wurde. Im Nachgang wurden alle MitfahrerInnen ebenfalls gespeichert.
Kritik vom Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Deutschland setzt sich seit 2007 dafür ein, eine entsprechende Datensammlung auf EU-Ebene einzurichten. Weil viele Mitgliedstaaten aber aus Gründen des Datenschutzes keine politischen AktivistInnen erfassen dürfen, gab es hierzu noch keine Einigung. Regelmäßig werden die deutschen Datensätze deshalb an Polizeien anderer Länder “ausgeliehen”, etwa zur Vorbereitung auf Gipfelproteste.
Die dubiosen Machenschaften beschäftigen auch Peter Schaar, den den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI). In seinem letzten Tätigkeitsbericht (pdf) kritisiert er, dass viele personenbezogenen Speicherungen ohne hinreichende Rechtsgrundlage erfolgen:
Im Ergebnis hat der Beratungs- und Kontrollbesuch gezeigt, dass teilweise zu weitgehende Speicherungen in der Zentraldatei “PMK-links-Z” erfolgt sind. Dies betraf oft Personen, die im Zusammenhang mit Versammlungen aufgefallen waren. In vielen Fällen war nicht ausreichend substantiiert dokumentiert, welche konkreten Handlungen ihnen vorgeworfen wurden und aus welchen Gründen die Speicherung erforderlich war.
Durch ein hartnäckig durchgekämpftes Auskunftsersuchen konnte ein auch im Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung engagierter Aktivist herausfinden, dass er in der “PMK-links-Z” landete weil er zuvor politische Versammlungen angemeldet hatte. Das LKA Berlin hatte dies ans BKA gemeldet – ein klarer Verstoß gegen das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Volkszählung:
Wer unsicher ist, ob abweichende Verhaltensweisen jederzeit notiert und als Information dauerhaft gespeichert, verwendet oder weitergegeben werden, wird versuchen, nicht durch solche Verhaltensweisen aufzufallen. Wer damit rechnet, daß etwa die Teilnahme an einer Versammlung oder einer Bürgerinitiative behördlich registriert wird und daß ihm dadurch Risiken entstehen können, wird möglicherweise auf eine Ausübung seiner entsprechenden Grundrechte (Art. 8, 9 GG) verzichten. Dies würde nicht nur die individuellen Entfaltungschancen des Einzelnen beeinträchtigen, sondern auch das Gemeinwohl, weil Selbstbestimmung eine elementare Funktionsbedingung eines auf Handlungsfähigkeit und Mitwirkungsfähigkeit seiner Bürger begründeten freiheitlichen demokratischen Gemeinwesens ist.
Der Betroffene hat jetzt beim LKA Berlin gegen die Weitergabe seiner Anmelderdaten Widerspruch eingelegt. Allerdings ist er mit einem weiteren Vorfall aus Berlin in der “PMK-links-Z” aktenkundig. Dies betrifft die Demonstration “Freiheit statt Angst” von 2010, anlässlich derer wegen “Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte” ermittelt wurde. Das Verfahren wurde später aus rechtlichen und tatsächlichen Gründen eingestellt. Die Staatsanwaltschaft zeigte sich überzeugt, dass dem Aktivisten keine Straftat vorgeworfen werden könne. Demnach wäre eine Speicherung in der Datei “PMK-links-Z” nicht länger zulässig. Eine Löschung der Daten des Aktivisten erfolgte dennoch nicht.
Der in den Akten behauptete “Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte” bezog sich übrigens auf die Begleitung der Demonstration im Spalier, was keine polizeiliche Zwangsmassnahme ist. Auch insofern ist ein angeblicher “Widerstand” also haltlos.
Die Anwältin des Betroffenen kritisiert die “PMK-links-Z” als effektive Abschaffung der Unschuldsvermutung. Die Folge sind weitere Repressalien, darunter sogenannte “Gefährderansprachen”, Personenkontrollen, Platzverweise, Aufenthaltsverbote, Ein- und Ausreiseverbote, weitere Ermittlungsverfahren oder Aufforderungen, sich als InformantIn zur Verfügung zu stellen.
Undurchsichtiger Datentausch mit ausländischen Polizeibehörden
Besonders problematisch wird die polizeiliche Speicherpraxis aber im internationalen Kontext, denn die getauschten Daten und auch die Fristen zur Löschung sind kaum überprüfbar. Zudem werden informelle Kanäle genutzt, etwa die “Police Working Group on Terrorism” (PWGT), ein Relikt aus den 70er Jahren. Offenkundig wurde dies im Rahmen eines eines “No Border Camps”, das 2010 zeitgleich zu einer europaweiten Gewerkschaftsdemonstration in Brüssel stattfand. Obwohl es keinerlei Vorkommnisse gegeben hatte, nahm die belgische Polizei 148 AktivistInnen des Camps fest, als diese an der Demonstration teilnehmen wollten. Insgesamt wurden während des Camps 380 Personen verhaftet.
Nach der beispiellosen Repressionswelle gab es einen kleinen Protest, wobei sechs Scheiben einer Polizeiwache beschädigt wurden. Dies nahm die belgische PWGT-Kontaktstelle zum Anlass, die Polizeibehörden aus 16 Ländern über Festnahmen ihrer Staatsangehöriger zu informieren (unter ihnen 88 Deutsche). Im Falle des BKA führte dies dazu, dass sie mit dem Vermerk “Angriff auf eine Polizeistation” gespeichert werden – obwohl dieser nachweislich mehrere Tage nach den Festnahmen stattfand.
Das Bundesinnenministerium findet das nicht schlimm und sieht keinen Anlass, den Wahrheitsgehalt der Informationen aus Belgien zu überprüfen. Denn die deutschen Betroffenen müssten zunächst in Belgien klagen:
Eine im Nachgang gerichtlich festgestellte Unrechtmäßigkeit der Maßnahme ist dem Bundeskriminalamt nicht bekannt geworden. Insbesondere liegen dem BKA keine Erkenntnisse vor, dass die in Gewahrsam genommenen Personen nicht an den politisch motivierten Straftaten beteiligt waren oder die Taten nicht rechtswidrig begangen wurden.
Der BfDI sieht das anders. Zwar bezieht er sich in seinem Bericht auf deutsche Behörden (denn für die belgische Polizei ist er nicht zuständig). Zur auch hierzulande üblichen, verzerrten “Sachverhaltsdarstellung schreibt er:
Bei meiner Kontrolle fiel mir auf, dass bei vielen als Beschuldigte bzw. Verdächtige gespeicherten Personen zweifelhaft ist, ob diese überhaupt an einer strafbaren Handlung beteiligt waren. Dies betrifft oft Fälle, in denen die Betroffenen Teil einer größeren Menschenmenge waren und nicht näher einer bestimmten Tätergruppe zugeordnet werden konnten. In solchen Fällen müssen jedoch tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, aus denen sich ergibt, weshalb eine festgestellte Person zum Täterkreis gehört bzw. ein entsprechender Verdacht hinsichtlich einer konkreten Straftat begründet werden kann.
Veranstaltung in Berlin
In Polizeidatenbanken mit dem Vermerk “Angriff auf eine Polizeistation” gespeichert zu sein ist derzeit mit großen Unannehmlichkeiten verbunden. Denn die Generalbundesanwaltschaft hat Ermittlungen an sich gezogen, nachdem gegen vor einer Polizeiwache in Hamburg und der Außenstelle des BKA in Berlin-Treptow Brandsätze gezündet wurden. Bislang wurden keine Fahndungserfolge erzielt. Ähnlich wie oben beschrieben haben die konstruierten Verdachtsmomente aber dazu geführt, dass kürzlich in mehreren Städten Hausdurchsuchungen stattfanden.
Um die informationelle Selbstbestimmung auch gegenüber der Polizei durchzusetzen, können Auskunftsersuchen gestellt werden. Dem BKA ist das aber unbequem. Im Falle des oben erwähnten Betroffenen haben die Bundeskriminalisten dem BfDI eine abenteuerliche Begründung serviert, um das Auskunftsersuchen zurückzuweisen. Denn sowohl ihm als auch seiner Anwältin sei nicht zu trauen. Der Petent gegenüber Netzpolitik:
Auch das Grundrechtsverständnis des BKA ist skandalös: Obwohl ich durch die Auskunfts nach § 19 BDSG lediglich meine informationelle Selbstbestimmung wahrnehmen und die gespeicherten Daten erfahren wollte, wurde mir und meiner Rechtsanwältin umgehend unterstellt, dass unser “Ziel und Hauptmotiv” angeblich die Offenlegung von Dienstgeheimnissen des BKA wären. Als Beleg für diese Unterstellung dient dem “Staatsschutz” ein im Internet veröffentlichtes Zitat aus meinem Widerspruchsbescheid.
Am nächsten Montag (3. Juni 2013) wird der gesamte Vorgang im Rahmen einer Informationsveranstaltung “Informationelle Fremdbestimmung: BKA-Märchenstunde und die Wirklichkeit” in Berlin öffentlich gemacht. Die Gruppe Out of Control Berlin lädt hierfür ab 20.00 Uhr ins Café Größenwahn in der Kinzigstraße 9 in Friedrichshain.
Die Auskunftsersuchen in polizeilichen Datenbanken können übrigens bequem über den “Auskunftsgenerator” von Datenschmutz gestellt werden.
Wir wollen netzpolitik.org weiter ausbauen. Dafür brauchen wir finanzielle Unterstützung, auch um weiterhin einen Full-RSS-Feed anbieten zu können. Investiere in digitale Bürgerrechte.